Oberflächenscanning statt Tattoos
Bei Strahlentherapie denken viele an einen Laser, der mit einem leuchtenden Strahl auf den Körper zielt – und manchmal auch an einen kleinen, eingebrannten Punkt auf der Haut. Und so ganz falsch sind diese Vorstellungen nicht. Die Strahlen sind zwar unsichtbar, doch die Markierungen auf der Haut wirken wie Tätowierungen. Sie gehen nie mehr weg. «Früher war es gängige Praxis, Patientinnen und Patienten für die Lagerung zu markieren – meist mit kleinen, dauerhaften Tattoos», erklärt PD Dr. Tobias Finazzi, Leiter der Radioonkologie am KSB. Nur: Viele Betroffene empfinden diese Markierungen als belastende Erinnerung an die eigene Krebserkrankung, fühlen sich ein Leben lang gezeichnet.
Im KSB ist diese Praxis Geschichte. Statt auf die Haut zu tätowieren, scannt ein hochmodernes Kamerasystem die Körperoberfläche der Patienten. Oberflächenscanning heisst dieses Verfahren. Mehrere Kameras erzeugen in dem von Tageslicht gefluteten Raum im Kubus des KSB ein 3D-Modell des Körpers. Dieses Modell wird dann präzise mit der geplanten Bestrahlungsposition abgeglichen. Die Bestrahlung kann anschliessend punktgenau stattfinden. «Wir überwachen die Patienten während der Bestrahlung in Echtzeit. Wenn sie sich bewegen, wird die Sitzung sofort unterbrochen», sagt Tobias Finazzi.
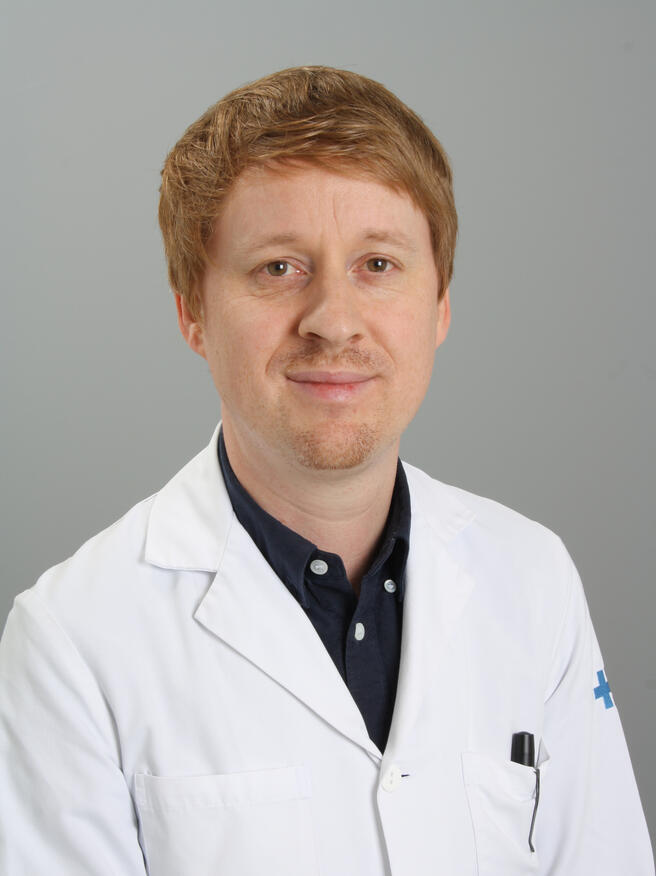
«Unser Ziel ist es, die Behandlung so wirksam und zugleich so schonend wie möglich zu gestalten.»
Leiter der Radioonkologie
Dieses Verfahren erlaubt nicht nur höchste Präzision, sondern eröffnet neue, schonende Möglichkeiten – etwa die sogenannte Atemanhaltetechnik: «Gerade bei Brustkrebs auf der linken Seite ist das ein grosser Vorteil. Hält die Patientin die Luft an, verschiebt sich die Brust vom Herzen weg – das Herz und die Lunge werden besser geschont», beschreibt Tobias Finazzi und holt wie zum Beweis selbst tief Luft.
Für die Betroffenen hat dieses Scanning zwei grosse Vorteile: mehr Komfort und zugleich mehr Sicherheit. Zudem herrscht in dem Raum, in dem im Jahr rund 10’000 Bestrahlungen stattfinden, ein angenehmes Ambiente. «Die Patienten blicken während der Bestrahlung ins Grüne», sagt Kirsten Steinauer, stellvertretende Leiterin der Radioonkologie am KSB: «Das Tageslicht schafft eine beruhigende Stimmung. Eine solche Infrastruktur ist in der Schweiz einmalig.»
Die Erfolge dieser Behandlung lassen sich auch an anderen Parametern messen: Inzwischen zeigen Studien, dass die Genauigkeit des Oberflächenscannings den klassischen Methoden überlegen ist. Die Technologie trägt damit nicht nur zur seelischen Entlastung der Patienten bei, sondern verbessert auch die medizinische Qualität der Therapie.

Hochpräzise Strahlung statt langer Therapien
Neben dem Verzicht auf Hautmarkierungen hat das KSB den Zeitaufwand und die Belastung durch die Behandlung verringert. Möglich macht das eine hochpräzise Technik namens «stereotaktische Bestrahlung» – auch wenn der sperrige Begriff in der Patientenkommunikation selten verwendet wird. Was zählt, ist das Ergebnis. Also kürzere Therapiezeiten bei oft noch besserer Wirksamkeit.
«Früher mussten die Patienten meist sechs bis sieben Wochen lang täglich zur Strahlentherapie kommen. Es waren 30 bis 35 Sitzungen erforderlich», rechnet Tobias Finazzi vor: «Heute schaffen wir in vielen Fällen vergleichbare, oft sogar bessere Resultate in nur fünf bis zehn Sitzungen.» Möglich macht das ein moderner Linearbeschleuniger.
Dieses Gerät kann Tumore millimetergenau erfassen und bestrahlen – mit hoher Dosis, aber ohne das umliegende Gewebe unnötig zu schädigen. Das gilt sowohl für Tumore im Frühstadion als auch bei komplexeren Fällen. «Gerade bei Patienten, die nicht operiert werden können oder möchten, ist das eine Option», betont der Radioonkologe. Als Beispiel nennt Finazzi frühe Stadien von Lungenkrebs, die heute mit nur wenigen Sitzungen effektiv behandelt werden können – mit Erfolgschancen von über 90 Prozent.
Das Geheimnis liegt in der Kombination aus hochauflösender Bildgebung, exakter Planung und punktgenauer Strahlung. Tobias Finazzi jedenfalls ist von den Möglichkeiten in der Radioonkologie des KSB begeistert. Auch, weil sie das Produkt von Teamplay sind. «Wir integrieren CT- und MRT-Daten sowie nuklearmedizinische Bilder in die Therapieplanung. Vor jeder Sitzung prüfen wir nochmals genau, ob der Tumor richtig liegt – und nur dann wird bestrahlt.»
Was technisch anspruchsvoll klingt, hat für die Betroffenen positive Nebenwirkungen: weniger Termine, weniger Belastung – und eine Strahlentherapie, die sich besser in den Alltag integrieren lässt. «Unser Ziel ist es, die Behandlung so wirksam und zugleich so schonend wie möglich zu gestalten», sagt Tobias Finazzi. Auch weil der ohnehin fordernde Alltag bei einer Krebserkrankung belastend genug ist.



